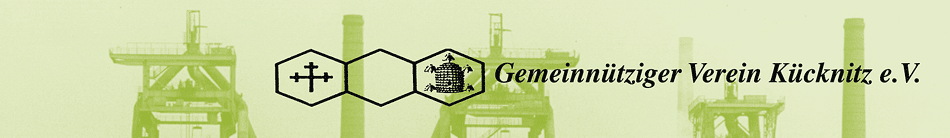 |
||||||||||
|
Das lübsche Forsthaus Waldhusen von 1765Wird die Stadt dieses kulturhistorische Kleinod verlieren?von Hans Rathje Reimers, Kücknitz den 06.02.2006 und Ergänzung vom 14.08.2009
Das Forsthaus Waldhusen nahe dem Ortsteil Kücknitz befindet sich zurzeit noch im Eigentum des St. Johannis-Jungfrauenklosters zu Lübeck. Der umliegende Wald wirft seit nahezu 700 Jahren seine Erträge für das Kloster ab. Der Zweck der heutigen Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster besteht laut Satzung darin, gemeinnützige und mildtätige Zwecke zu erfüllen, insbesondere ein Stift für alleinstehende Damen über 50 Lebensjahre zu unterhalten. Der Name Waldhusen taucht ab 1715 in den Akten des klösterlichen Archivs auf. Die Entstehung des heutigen Gebäudekomplexes Waldhusen hängt mit den Bemühungen des Klosters zusammen, die Waldwirtschaft in den klösterlichen Wäldern des Travemünder Winkels in geordnete Bahnen zu lenken,. Unerlaubte Rodungen und Holzdiebstähle hatten die Wälder stark mitgenommen. Die den Bauernvögten der umliegenden Ortschaften aufgetragene Aufsicht hatte nicht gefruchtet und konnte es auch wohl nicht. Sie hatten die gleichen Interessen am Wald wie die übrigen Dorfschaftsgenossen, lebten mit ihnen zusammen in der Dorfgemeinschaft und waren oft mit ihnen verschwägert. Kein Wunder, dass sie ihre Dorfgenossen nicht wegen irgendwelcher Waldvergehen bei der Obrigkeit anschwärzten.
Um diesen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen, begann das Kloster ab 1715 unabhängige Holzvögte für ihre Wälder zu bestellen. Da diese, wenn sie in den Dörfern wohnten, von den Dörflern kontrollierbar waren, baute man ihnen abseits der Dörfer Wohnungen in den Wald hinein, meist an den Zugängen zum Wald. So auch in Waldhusen. Die Holzvögte - später auch Förster genannt - setzten die obrigkeitlichen Verfügungen zum Schutze der Wälder gegen die Dorfeingesessenen durch und machten sich diese deshalb oft zum Feind. Verachtung für den Holzvogt, der auch wirtschaftlich und sozial weitaus schlechter gestellt war als die Bauern, war die selbstverständliche Folge. Der geringschätzige Satz: "Der haust ja auch im Walde!" war der Ursprung des Namens für das hiesige Forstgehöft. Als der Beruf des Holvogtes durch die Aufgaben der Waldwiederbegründung und -pflege zusätzlich zu den bisherigen Schutzfunktionen aufgewertet wurde, gestand man ihm auch ein höheres Gehalt, mehr Dienstland und eine größere Dienstwohnung zu. Der Holzvogt zog als Förster aus seiner auch heute noch vorhandenen Kate in das 1765 erbaute Forsthaus um. Das Forsthaus Waldhusen hatte die Ausmaße eines normalen Bauernhauses und wurde auch im gleichen Stil erbaut. Dem Förster wurde Land zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung zugewiesen, das in etwa dem eines Hufners entsprach. Nun konnte der Förster den Hufnern der umliegenden Dörfer auf gleicher Augenhöhe begegnen und somit effektiver den Ausgleich der Interessen zwischen Wald und Dorfschaft befördern. Dieser Prozess endete mit der Ablösung der Allmende und verschaffte den Bauern das persönliche Eigentum an ihrem Land, bedeutete aber gleichzeitig die Aufhebung aller Rechte der Dorfschaften am Wald. Damit war auch der Grund gelegt für die Aussöhnung zwischen Förstern und Bauern. Die grundherrschaftlichen Anforderungen an den Beruf des Försters stiegen weiterhin und die forstwissenschaftlichen Kenntnisse machten erhebliche Fortschritte. Der empirisch gebildete Förster reichte dem Kloster nicht mehr; es stellte 1806 einen akademisch ausgebildeten Forstmann an. Dieser hob sich finanziell und bildungsmäßig deutlich von der Dorfbevölkerung ab. Das musste natürlich auch nach außen hin dokumentiert werden. So bekam 1807 das Forsthaus Waldhusen einen größeren Anbau und einen vorgelagerten Park und damit seinen "herrschaftlichen" Charakter.
Dieser mag auch den Dichter Emanuel Geibel (1815-1884) angezogen haben, der einige Zeit im Forsthaus lebte und dichtete. Das Geibel-Zimmer mit Blick auf die Waldwiese erinnert noch heute daran. Alle drei beschriebenen Stufen der soziologischen Entwicklung des Berufes des Forstmannes lassen sich an den Baulichkeiten des Forsthauskomplexes Waldhusen noch heute in reiner Form und in ungestörter Folge ablesen:
Dieses Ensemble stellt also ein einmaliges Denkmal der
sozio-kulturellen Entwicklung eines Berufsstandes dar, der über
Jahrhunderte hinweg ökonomische, kulturelle und landschaftsgestaltende
Funktionen wahrgenommen hat und noch heute wahrnimmt. Wegen seiner bauhistorischen Bedeutung steht das Forsthausensemble
Waldhusen unter Denkmalschutz. Die soziokulturelle Bedeutung wurde bisher
wenig wahrgenommen und erörtert, ist aber mindestens ebenso bemerkenswert
wie der bauliche Wert und von überregionaler Bedeutung im norddeutschen
Raum. Dass der Forsthauskomplex Waldhusen nach fast 300 Jahren immer noch
seiner ursprünglichen Zweckbestimmung dient, ist außergewöhnlich und
hebt den Wert der Anlage deutlich. Das Forsthaus Waldhusen diente
14 Forstleute hatten bisher das Forsthaus Waldhusen als Dienstsitz inne:
Die Zukunft dieses bemerkenswerten Forsthauses sieht düster aus.
Natürlich bin ich als bisher letzter im Forsthaus Waldhusen wohnhaft gewesener Förster befangen und habe auch ein ganz persönliches Interesse am Fortbestehen des forstlichen Dienstsitzes Waldhusen. Über 40 Jahre habe ich dort wohnend und für den Wald wirkend zugebracht. Beides hat mich sehr ausgefüllt und befriedigt. Mein Herzblut hängt an diesem Haus und an dem umliegenden Waldrevier! Um so mehr macht es mich betroffen, dass demnächst die lange traditionsträchtige Ära dieses Forststandortes zu Ende sein könnte. Wie es scheint soll das Forsthaus Waldhusen wohl für gewerbliche Zwecke meistbietend an Fremde verkauft werden. Das St. Johanniskloster als derzeitiger Eigentümer hat nicht die Mittel, weiterhin als Träger dieses Hauses zu fungieren. Die Stadt weigert sich, das Forsthaus zu übernehmen. Dabei müsste gerade sie ein gesteigertes Interesse am Erhalt des Forststandortes haben. Zwei Drittel der von Waldhusen aus bewirtschaften Flächen gehören der Stadt, ein Drittel den Stiftungen. Gerade die Stadt braucht den Verwaltungsmittelpunkt für das Revier, eine Dienstwohnung für den neuen Förster, Platz für Naturbildungsangebote u.a. Das Forsthaus Waldhusen ist der verwaltungsmäßige Mittelpunkt für ein Gebiet, das umgrenzt wird von den Waldungen auf dem Priwall, am Brodtener Ufer, in Schwochel und Schwinkenrade in der Gemeinde Ahrensbök, auf dem Krumbecker Hof in der Gemeinde Stockelsdorf, von den Roggenhorster Aufforstungen und von der Lehmbeck bei Reecke. Diese Waldflächen verteilen sich auf die Besitzer Hansestadt Lübeck, St. Johannis-Jungfrauenkloster, Heiligen Geist Hospital und Kurverwaltung Travemünde. Das Forsthaus Waldhusen ist im Bewusstsein der umliegenden Ortschaften ein fester Anlaufpunkt für Holzinteressenten (jährlich an die 300) und Bürger, die Auskünfte wünschen über Wald, Tiere und Naturschutzfragen. Die wöchentliche Sprechstunde am Mittwoch Vormittag ist stets zeitlich voll ausgenutzt durch Besucher. Diese hätten sicher kein Verständnis dafür, wenn die Forstdienststelle an einen anderen, den Besuchern unbekannten, wahrscheinlich auch ungünstigeren Ort verlegt würde. Viele besorgte Anfragen, was denn wohl mit der Försterei geschehen werde, wenn der Verfasser dieser Zeilen in Pension gehe, zeugten schon im letzten Jahr von der Verunsicherung bei der umwohnenden Bevölkerung, aber auch von der Wertschätzung des alten Forsthauses. Das Forsthaus ist groß, weil es einst als Sitz des leitenden Oberförsters erbaut wurde, dem ein landwirtschaftlicher Betrieb angeschlossenen war. Es ist deshalb auch teuer in der Unterhaltung. Die logische Konsequenz aus den bereits gesagten ist:
Diesem Ziele dienten die vom Bereich Stadtwald Lübeck initiierten und vom Gemeinnützigen Verein (Muttergesellschaft und Tochter Kücknitz) bewirkten und vom dem Architekten Justus Deecke angestellten "Überlegungen über zukünftige Nutzungsmöglichkeiten des Forsthauses Waldhusen". Neben der Dienstwohnung für den Förster sind vier weitere Wohneinheiten, daneben die heutige Tenne als Seminarraum, Räume für Waldjugendgruppen und für einen Waldkindergarten angedacht. Die Mittel hierfür könnten durch Spenden aufgebracht werden. Meines Wissens hat der zuständige Senator für Umwelt diesbezüglich bereits erste Gespräche aufgenommen. Wenn das Forsthaus von 1765 in der Verwaltung der Hansestadt Lübeck bliebe, wäre viel Positives erreicht:
Man wird einer großen Vergangenheit und einer würdigen Zukunft nicht dadurch gerecht, dass man den finanziellen Vorteil um jeden Preis maximiert. Der gute Lübecker Kaufmann und hansestädtische Politiker wusste das und optimierte seine Geschäfte - unter Berücksichtigung des Wohls seiner Heimatstadt.. In Anlehnung an Ralf Dahrendorf möchte die neue Direktorin der "Gemeinnützigen" diejenigen Bürger und Ziele unterstützen, die "keinem platten Ökonomismus huldigen und Wertefragen nicht unter den Tisch fallen lassen". Das Ende der Geschichte eines traditionsreichen Forsthauses und eines Geibel-Hauses steht bevor - mitten in der Weltkulturerbestadt Lübeck, wenn die Lübecker Politik nicht entsprechend handelt! Das historische Forsthaus Waldhusen von 1765 muss der Stadt erhalten bleiben!
|
![Forsthaus Waldhusen [Foto: Macziey]](../images/Waldhusen1-M.jpg)
![Forsthaus Waldhusen [Foto: Macziey]](../images/Waldhusen3-M.jpg)
![Forsthaus Waldhusen [Foto: Macziey]](../images/Waldhusen4-M.jpg)
![Forsthaus Waldhusen [Foto: Macziey]](../images/Waldhusen2-M.jpg)
![Forstkate Waldhusen [Foto: Meier]](../images/wohlert1-S.jpg)
![Forstkate Waldhusen [Foto: Macziey]](../images/Forstkate-M.jpg)